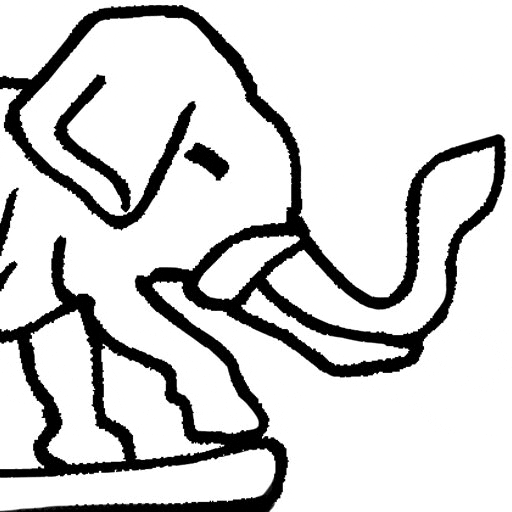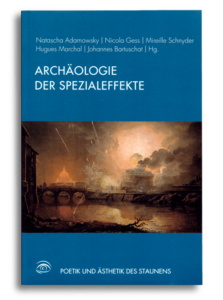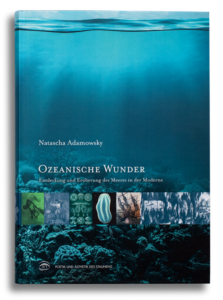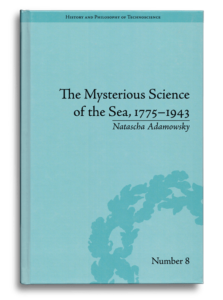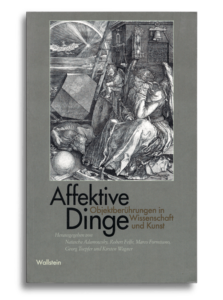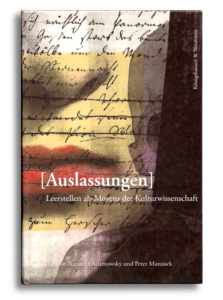VITA
Ich bin Medien- und Kulturwissenschaftlerin und habe seit 2020 den Lehrstuhl für Medienkulturwissenschaft mit dem Schwerpunkt Digitale Kulturen an der Universität Passau inne. Zuvor war ich Professorin für Medienwissenschaft im Bereich der Digitalen Medientechnologien an der Universität Siegen, Professorin und Leiterin des Instituts für Medienkulturwissenschaft an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg sowie Professorin für Kulturwissenschaftliche Ästhetik am Institut für Kulturwissenschaft der Humboldt Universität zu Berlin.
weiter lesen
Meine Arbeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen
- kulturwissenschaftlicher Digitalitätsforschung,
- medienwissenschaftlicher Spielkulturforschung,
- Medienästhetik und Wissenskultur,
- sowie Medientechnik und -geschichte.
Publikationen (kleine Auswahl): Technik und Lebendigkeit – Automaten, Androiden, Avatare, Wien 2020; Archäologie der Spezialeffekte, München 2018; Ozeanische Wunder. Entdeckung und Eroberung des Meeres in der Moderne, München 2017; Mysterious Science of the Sea, 1775 – 1943, London 2015; Das Wunder in der Moderne. Eine andere Kulturgeschichte des Fliegens, München 2010; Spielfiguren in virtuellen Welten, Frankfurt 1999.
Forschung
Mein Interesse gilt der Entwicklung einer geisteswissenschaftlich orientierten Grundlagenforschung als Kernelement einer neuen Kulturwissenschaftlichen Digitalitätsforschung.
Forschungsthemen
Den digitalen Wandel verfolge ich unter den Schlagworten Digitalisierung, Automatisierung und KI: Dies betrifft konkret:
- die sich mit digitalen Objekten und Infrastrukturen etablierenden Mensch-Umwelt-Beziehungen,
- die mit einer ubiquitären Vernetzung verbundenen Formen der Teilhabe (wie des Ausschlusses),
- die mit Digitalisierungsprozessen einhergehende Automatisierung und die daraus resultierenden Automatismen.
weiter lesen
Spiel/Zeug
Mich beschäftigt die historische Genese technischer Spielobjekte, konkret die Entwurfspraktiken (Design, Programmierung, Inszenierung, Konstruktion, etc.) von Spielzeugen und -anordnungen (Playgrounds) und deren kooperativen Potentiale. Perspektivisch geht es mir um die Beschreibung grundlegender Verbindungen zwischen Spiel und Technik, nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund ludischer Anwendungen für die Entwicklung und Gestaltung der aktuellen Computer- und Internetkultur.

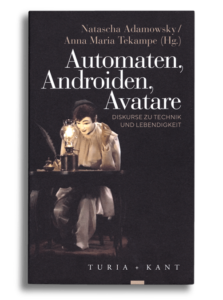
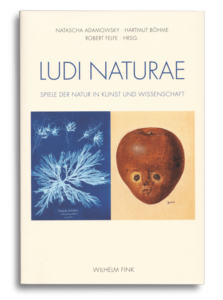
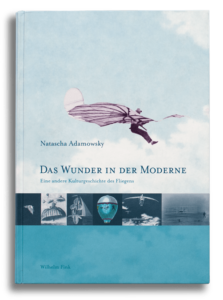

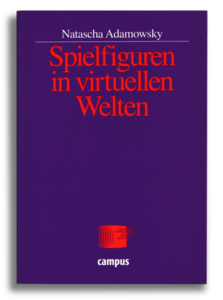

Aufsätze
- Knowledges. Submarine Discoveries: Wonderful Facts and Monstrous Encounters. In: Margaret Cohen (Hg.), A Cultural History of the Sea in the Age of Empire, Vol. 5, Bloomsbury Press, 2021 (im Erscheinen).
- Fauxtomation – Gedanken zu Geschichte und Ästhetik ‚intelligenter‘ Technik. Internationales Jahrbuch für Medienphilosophie, Band 6 Digital/Rational (2020), S. 265–278.
- Einleitung. In: Adamowsky, Tekampe (Hg.), Automaten, Androiden, Avatare. Diskurse zu Technik und Lebendigkeit, Wien 2020, S. 1–5.
- Unheimliche Lebendigkeit. Jahrbuch Technikphilosophie, Autonomie und Unheimlichkeit, 6. Jg. (2020), S. 19–32.
- Das Erlebnis einer Luftreise – eine ästhetisch-poetische Spurensuche. In: Matthias Winzen (Hg.), Die Welt von oben. Der Traum vom Fliegen im 19. Jahrhundert, Baden-Baden 2019, S. 117–142.
- Spiel/en. In: Daniel M. Feige, Sebastian Ostritsch, Markus Rautzenberg (Hg.), Philosophie des Computerspiels. Ästhetik – Theorie – Praxis, Stuttgart 2018, S. 27–42.